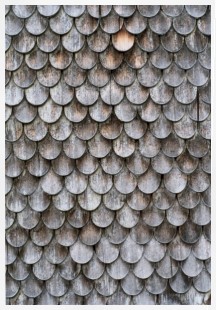Holz im regenreichen Norden
Deckelschalung
Konstruktive Grundregeln zur Herabsetzung der
Schlagregenbeanspruchung
Infos für Selbermacher
Fast vergessen - Dacheindeckung und Wandverkleidung mit
Holzschindeln
Holzschindeln-Manufakturen
Deckelschalung
In den Gebirgs- und Mittelgebirgslagen ist die Verkleidung von Bauwerken mit
Holzfassaden traditionell weit verbreitet. Sicher wird dies durch den regionalen
Holzreichtum begünstigt, aber die bekannt rauhe Wetterlage in diesen Breiten
deutet darauf hin, dass Holzverschalungen an Bauwerken sich hier bestens
bewährt haben und auch augenscheinlich wenig schadensanfällig sind.

|

|
Berghütte mit Stall in Westnorwegen. Beide wurden mit örtlicher
Kiefer bzw. Fichte mit nur konstruktivem Holzschutz erbaut. Sie dienen heute
noch als Sommerhäuschen. Foto: Rüpke
|
Neues Sommerhäuschen in traditioneller Bauweise mit Erddach mit nur
konstruktivem Holzschutz. Die verwendeten Materialien entstammen dem Baumarkt
und der Umgebung. Foto: Rüpke
|
Besonders interessant ist die frühere Verwendung unbehandelten,
sägerauhen Holzes als Brettware in recht großen Dimensionen. Die damals
verbauten Bretter in Abmaßen von 30-40 cm Breite sind heute kaum mehr am Markt
beschaffbar.
Als Holzart ist z.B. im Harz die Tanne und später die Fichte an erster
Stelle. Diese Holzarten haben an den Außenwänden traditioneller
Harzhäuser bereits viele Generationen und auch maches offene Nadelholzfachwerk
überlebt. Fichte und Tanne, im Regenschatten schwarzgrau und an der
Wetterseite fast silbrig ausgewaschen, beweisen uns hier, dass Nadelholz mit
ausreichend Schlagregenschutz ohne jeden Anstrich länger haltbar ist, als wir
es von heutiger Baumarktware zu kennen gewohnt sind.

|

|
Nach Jahrzehnten ist das Grasdach verwildert und von Bäumen
bewachsen. Die Birkenrinde verliert durch Verwurzelung und nach Abbau der
wirksamen Inhaltsstoffe die Dichtigkeit. Foto: Rüpke
|
Ein Grasdach will stetig instand gehalten werden, wobei der Zyklus durch
die Auswechslung der Birkenrinde bestimmt war. Die hier eingebaute
PE-Noppenbahn ersetzt heute die Birkenrinde. Foto: Rüpke
|
Die Gründe für Erfolg und Versagen liegen an der Gestaltung der
Umgebungsbedingungen und der Beachtung von konstruktiven Erfordernissen. Eine
wirksame, langlebige Holzverschalung gewinnt mit der Zielvorgabe, Wasser schnell
und ohne Staunässe vom Bauwerk weg abzuführen. Nur so kann die
Verschalung regelmäßig wieder schnell und nachhaltig trocken. Ist das
Holz (so einfach) geschützt, bleibt auch das Haus trocken.

|

|
| Auch beim Neubau ist die Birkenrinde noch unterhalb der PE-Folie vorhanden,
nun als Tropfkante. An den Ortgangbrettern und Windrispen sind an eben
liegenden Stößen die Oberseiten mit Blech gegen Wasser
geschützt. |
|
Ein chemischer Holzschutz ist an Fassadenschalungen grundsätzlich nicht
nötig. Nur die Anfälligkeit von Anstrichen erfordert u.U. einen
Bläueschutz. Richtig geplant und gebaut, sind Anstriche auf Holz .
Konstruktive Grundregeln zur Herabsetzung der
Schlagregenbeanspruchung
|
Dachüberstand
nach
Gebäudehöhe
|
|
Bei hoher Bauweise
geschossweises Auskragen
nach oben hin
|
|
Sockelbereich muss 30 cm hoch frei bleiben,
Spritzwasserzone
|
|
Spritzwasserschutz
am Sockel ausbilden
|
|
Abdichtungsmaßnahmen
bis unter die Schalung
führen (DIN 18 195 u.a.m)
|
|
Schlagregen muss zügig, ohne Stau ablaufen
können
|
|
Holzart
je nach
der Beanspruchung im Einzelfall wählen (z.B. in der
Gefährdungsklasse
2-3 die
Dauerhaftigkeitsklase
3-4, etwa Lärche,
Douglasie, bei gutem Wetterschutz auch Tanne, Fichte möglich (Kiefer wegen
Bläuegefahr
meiden). Regional Bewährtes
immer vorziehen !
|
|
Rechte und linke Seiten der
Bretter
vorsortieren, um durch nachträgliche Formänderungen
entstehende Fugen klein zu halten (Obacht! Profilierte Bretter haben hierbei
gegenüber sägerauhen Nachteile)
|
|
Verschalung muss wirksam hinterlüftet
werden
|
|
Fugen
müssen zwar dicht, aber genug weit
sein, um kapillaren Wasserstau zu vermeiden (Wasser schießt in Quetschfuge
und erzeugt Staunässe)
|
|
Holzfasern
sollen in der Wasserabführrichtung
verlaufen
|
|
Tropfkanten
mit
unterseitig eingelassener Nut und Ablauf mit Gefälle an waagerechten
Einbindungen
|
|
Mögliche
Brettlängenstöße
müssen mit Abstand überlappen und eine scharfe Tropfkante haben
|
|
Spritzwasserfallen
in Fensternischen sind durch ausreichenden Vorstand zu vermeiden
|
|
Hier ist kein chemischer Holzschutz nötig, keine Schädigung
durch Insekten zu erwarten !
Hinterlüftete Holzfassaden, aber auch
richtig
konstruierte Zäune, Pergolen usw., die immer
wieder schnell austrocknen können, benötigen, soweit kein
Bodenkontakt gegeben ist,
keinen chemischen Schutz
gegen Pilzbefall.
Dies wurde unter anderem in einer von der Bundestiftung Umwelt
geförderten Studie über Lärmschutzwände aus Holz
nachgewiesen.
Eine Schädigung durch holzzerstörende Insekten
ist nicht zu erwarten
und kommt bei freier Bewitterung nur dann vor,
wenn gleichzeitig Pilze tätig sind. Lediglich Wespen schaben
häufig die Holzoberflächen ab, um Baumaterial für ihre
kunstvollen Nester zur gewinnen.
|
| Zur Konstruktion die bewährten
Angaben aus der Fachliteratur beachten. Historische Verschalungen der
regionalen Bauweisen können oft einfacher und wirksamer sein. Achten Sie
mal darauf. |

|

|
| Klassische einfache waagerechte
Holzverschalung neuerer, regional typischer Siedlungsbauweise |
Hier fehlt der Giebeldachüberstand
kleinformatige Profilbretter werden der Witterung nicht lange trotzen |
In der näheren Umgebung findet sich nun bei einem Spaziergang die
Möglicheit, verschiedenste Holzfassaden anzuschauen. Dabei wird nun Ihr Blick
auf einige Details fallen. Sind die Giebelüberstände ausreichend, ist der
Sockelbereich spritzwassergeschützt, wie sind die Bretter an Stoßstellen
verbaut - kann das Wasser schnell entlang der Faser ablaufen und über die
Kanten tropfen? Wie sieht es an den Fenster aus - schützt die Fassade sie, ist
die Fensterbank mit Tropfkante genügend überstehend? Dann wird Ihr Blick
auch auf die Farbgestaltung fallen. Sie werden natürlich vergrautes Holz
erleben und bei genauerem Hinsehen den aussichtslosen Kampf der
"honiggelbes-Holz-will-ich-haben-Liebhaber" gegen die Gesetze der Natur
entdecken.
Infos für die Selbermacher
| Literatur zum Thema "zeitgemäße
Holzfassaden" |
|
 Die Broschüre der
Holzforschung Austria
gibt neben dem Stand des Wissens die aktuellen Ergebnisse eines
Fassaden-Projektes wieder. Sie erfahren Wissenwertes über
unterschiedliche Holzmaterialien, richtige Oberflächenbehandlung,
Befestigung und Montage. Beispiele und die wichtigsten Konstruktionsregeln
werden aufgeführt. Preis: 38,50 Euro (plus Versand; Verkauf bzw.
Versand nur gegen für uns spesenfreie Bezahlung). Beispielseiten:
Inhaltverzeichnis
,
Material
,
Detailansicht
und das
Bestellformular
Die Broschüre der
Holzforschung Austria
gibt neben dem Stand des Wissens die aktuellen Ergebnisse eines
Fassaden-Projektes wieder. Sie erfahren Wissenwertes über
unterschiedliche Holzmaterialien, richtige Oberflächenbehandlung,
Befestigung und Montage. Beispiele und die wichtigsten Konstruktionsregeln
werden aufgeführt. Preis: 38,50 Euro (plus Versand; Verkauf bzw.
Versand nur gegen für uns spesenfreie Bezahlung). Beispielseiten:
Inhaltverzeichnis
,
Material
,
Detailansicht
und das
Bestellformular
|
| Beispielhafte Bauanleitungen für den
Selbstbauer |
|
|
Fast vergessen - Dacheindeckung und Wandverkleidung mit
Holzschindeln
Die im kälteren Europa traditionelle Verwendung von Holzschindeln für
den Wetterschutz von Gebäuden demonstriert einmal mehr die natürliche
Beständigkeit von chemisch nicht geschütztem Holz auch unter extremer
Witterungsbelastung. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings zum einen die
richtige Auswahl und Bearbeitung des Holzes (z.B. Fichte, Lärche, Eiche) und
zum anderen eine geeignete Konstruktion. In Schnitt hält eine entsprechend
gebaute Schindelfassade 70 bis 100 Jahre, eine mehrschichtige Lärchenfassade
ohne weiteres 150 Jahre. Wegen dieser langen Lebensdauer rechnet sich eine
Schindelfassade wirtschaftlich, auch wenn sie je qm zwischen 140 und 250 Schweizer
Franken kostet.

|
Asbestplatten verbergen die alte historische Deckung aus Holzschindeln
(Norwegen). Foto: Rüpke
|
Einer der letzten Schweizer Schindelmacher, Peter Müller, (
http://www.holzschindeln.ch/firma.htm
) berichtet:
"Zum Schindelnmachen braucht es alte Bäume, 100 bis 200 Jahre sollten sie
idealerweise zählen, in mittlerer Höhe auf 800 bis 1200 m und vom
Jahrringverlauf ruhig und gleichmäßig gewachsen sein."
Das Aussuchen und Aufspalten (bei gesägten Schindeln werden zu viele
Holzzellen angeschnitten!) ist eine Handwerkskunst. (Quelle: Klein, S. 2000.
"Schindeli-Müller", einer der letzten Schindelmacher. Holz-Zentralblatt 126
(120), S. 1616)
Ausführliche Informationen zu allen Aspekten der Verwendung von
Holzschindeln finden Sie auf der Homepage der Firma Theo Ott:
http://www.holzschindeln.de/
.
Ebenfalls sehr informativ sind die Seiten von Beyer Holzschindel in Österreich
(
http://www.holzschindel.at/
), u.a. mit Konstruktionsskizzen und einem
kleinen Quiz.


|
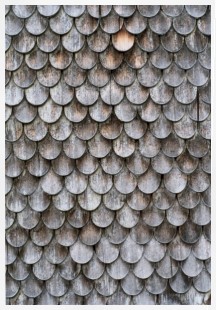
|
Holzschindeln
Holzart: Eiche, Buche, Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer und
Zerdernarten
Die DIN 68119 "Holzschindeln" definiert die Schindelarten und
Holzschindelsdeckungsweisen.
Die übliche Schindelformen:
- Nutschindel mit gleichblei-bender Dicke (parallel)
- Nutschindel (keilförmig) Schindelfuß dicker als -kopf
Zier- bzw. Schuppenschindeln
- mit gebrochenen Ecken
- mit halbrunden oder rechteckigen Fassungen
- in Segment- oder Rautenform
- in symmetrisch schräger Schwarzwaldform
Maße: b = 4-10, l = 15-30 cm
|
Betagte aber intakte
Holzschindeln
an der Hauptstraße in Furtwangen.
Natürlich, silbergrau schattiert, unbelastet von honiggelben Lasurgemixe
halten sie noch jedem Wetter stand. Diese Fotos, aus der Not heraus, einen
Film vollzumachen, verdanken wir:
Martin
Hupfer
|
Holzschindeln - Manufakturen / Handwerksbetriebe
Wir haben weitere Produzenten von Holzschindeln aufgespürt (
alle Angaben
ohne Gewähr
) und hernach für Sie zusammengefasst und freuen uns, wenn
diese Liste durch Ihre Mitteilung ergänzt werden kann:
|
In Deutschland gibt es die kleine
Holzschindel-Manufaktur
Markus Bischof
in Fritzlar (Hessen). Dort werden in handwerklicher
Tradition Holzschindeln in den Holzsorten Eiche und Buche (?) gesägt:
|

|
- in verschiedenen gängigen Formaten und Formen - nach DIN 68119
Güteklasse 1 beidseitig auf Mass gehobelt
- garantiert ohne liegende Jahresringe, weder ansatzweise noch
durchgehend
- wesentlich stärker als die DIN 68119 vorgibt
- auf der Oberfläche fast ohne Bearbeitungsspuren
- luftgetrocknet nach der Produktion
(die Materialkosten liegen pro m
2
bei etwa 40 - 50 Euro)
|

|
|
Der
Grasser Christian
(BZ / Südtirol) bemüht sich
seit nunmehr fast 10 Jahren, die in Südtirol weit verbreitete Tradition
des "Schindelkliabns" (Schindelspaltens) neu zu beleben und
weiterzuführen.
|

|
Der Grasser Christian fertigt
- Holzschindeln ausschließlich Lärchenholz. Holzdachrinnen aus
Lärchenholz, rustikal gehackt oder gefräst, in den Längen
von 2 bis 7 m in verschiedenen Querschnitten und
- traditionell geflochtene Lärchenholzzäune aus gespaltenen und
gespitzten Lärchenzaunlatten in Längen vom 90 cm bis 1,50 m.
|

|
|
Petr Rehák`s
Holzschindeln Manufaktur
aus Karolinka / Tschechien produziert,
liefert und montiert nach Form und Art regional anpasst in traditioneller
Herstellung gespaltene Holzschindeln.
|

|
Petr Rehák`s handgespaltene und handgeschabte (nicht gehobelte) Dach-
und Wand- Holzschindeln werden nach hundertjähriger Technologie in
verschiedenster Art hergestellt:
- Sichtflächen glatt abschabt mit abgeschnitten Kanten oder
- Sichtflächen nur gespalten, als
- Rundschindel
- Standardschindel
- Schwarzwaldschindeln
|

|

|









 Holzfragen.de zum Thema
Holzfragen.de zum Thema
 Die Broschüre der
Die Broschüre der